
Das Recherchieren und Aufspüren steht bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung immer am Anfang und kann hier schon einige Nerven kosten. In Großstädten sind Massenbesichtigungen heutzutage kein Fremdwort mehr. Doch ist dann endlich doch die persönliche Traumwohnung gefunden – sei es mit oder ohne Makler –, geht meistens alles ganz schnell: Mietvertrag unterschreiben, Umzug, Wohnen. Und plötzlich befinden Sie sich mitten drin in Angelegenheiten, die das Mietrecht betreffen.
In Deutschland lebten 2014 rund 36 Millionen Bürger in einem Mietverhältnis, das ist fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Circa 30 Millionen Menschen wohnten bereits im eigenen Haus und knapp fünf Millionen in einer Eigentumswohnung. Wohngemeinschaften wurden rund vier Millionen gezählt. Diese Zahlen wurden durch das Portal Statista ermittelt, im Auftrag der Allenbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA).
Doch beim Mieten geht es nicht nur um Wohnungen, auch Autos können gemietet werden oder Ferienhäuser. Das Mietrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das zwar in nur wenige Gesetze gegliedert ist auch ebenso kaum andere Rechtsbereiche berührt, trotzdem regelt es durch eine Vielzahl von Vorschriften alle Rechte und Pflichten von Mieter und Vermieter. Diese sollen in diesem Ratgeber im Mittelpunkt stehen.
Inhalt
FAQ: Mietrecht
Als Teil vom Zivilrecht ist das Mietrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Es regelt alle rechtlichen Belange rund um das Mieten und Vermieten von beweglichen sowie unbeweglichen Sachen.
Das deutsche Mietrecht umfasst zahlreiche Gesetze und Verordnungen. Hier erhalten Sie einen Überblick.
Liegen Sachmängel vor oder ist ein Gebrauch der Mietsache nicht im vertraglich vereinbarten Rahmen möglich, können Sie ggf. eine Mietminderung erwirken. Mehr dazu lesen Sie hier.
Spezielle Ratgeber zum Thema Mietrecht
Grundzüge des Mietrechts
Das Mietrecht ist Teil des Zivilrechts und daher auch zum Großteil im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Miete bezeichnet im Mietrecht eine zeitweilige, kostenpflichtige/entgeltliche Überlassung einer beweglichen oder unbeweglichen Sache zu dessen Nutzung. Eine bewegliche Sache kann zum Beispiel ein Pkw sein, wie ein Mietwagen. Unbewegliche Dinge sind dann Häuser, Grundstücke oder Wohnungen. Vor der neuen Mietrechtsregelung (2001) war die Miete auch als Mietpreis und Mietzins bekannt. Heute ist die alleinige Bezeichnung Miete üblich.
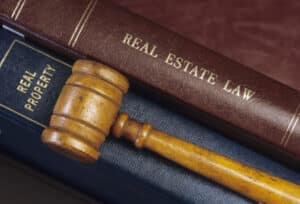
Damals war das Mietrecht auch noch eher ungegliedert und in verschiedenen Nebengesetzen verteilt. Nach der Reform sind diese ganzen Vorschriften zum Mietrecht mit Inkrafttreten des Mietrechtsreformgesetzes in das Bürgerliche Gesetzbuch übernommen worden. Daher sind jetzt die Paragraphen so gegliedert, dass sie den typischen Verlauf eines Mietverhältnisses abhandeln. Zudem wurden amtliche Überschriften eingefügt, die das Lesen sowohl für einen Hausbewohner als auch für den Hauseigentümer erleichtern.
Ein Mietverhältnis findet immer zwischen einem Vermieter und einem Mieter statt. Dabei zieht es auch stets einen Mietvertrag mit sich. Der Mietvertrag kann als Kernstück vom Mietrecht angesehen werden. Daher erhält er in diesem Ratgeber einen eigenen detaillierten Abschnitt zur Erläuterung aller wichtigen Bestimmungen zum Mietvertrag.
Als Mieter gilt laut Mietrecht dabei grundsätzlich die Person, die im Mietvertrag aufgeführt ist und das Mietverhältnis mit dem Hauseigentümer eingeht. Er ist auch derjenige, welcher den Vertrag unterschreibt.
So sollten Ehegatten beide im Mietvertrag aufgeführt sein und diesen auch beide zu unterschreiben, sofern die Eheleute gemeinsam Mieter einer Wohnung sein wollen. Allerdings haben zum Teil einige Gerichte bereits entschieden, dass es ausreicht, wenn nur einer der Ehepartner den Vertrag unterzeichnet.
Vermieter ist im Mietrecht die Person, die im Mietvertrag auch als solcher benannt ist. Er hat den Vertrag persönlich zu unterschreiben. In vielen Fällen unterzeichnet jedoch mittlerweile die Hausverwaltung als Vertretungsorgan für den eigentlichen Hausbesitzer.
Sprechen Menschen von einer Pacht, dann tritt beim Mietpreis sozusagen noch das Ziehen von Früchten hinzu. Das ist u. a. der Fall, wenn jemand Land mietet und dort eventuell etwas anbaut (Ackerbau, Obstplantage).
Relevante Gesetze und Rechtsverordnungen
Maklergesetz
Im Mietrecht handelt es sich bei einem Makler grundsätzlich um einen Immobilienmakler. Der Makler hat die Aufgabe als Vermittler einem Auftraggeber zum Abschluss eines Vertrages zu bringen, indem er ihm zu einem Wohnverhältnis verhilft. Dieser Vertragsabschluss findet zu einer bestimmten Gelegenheit statt. Dafür hat der Makler Anspruch auf ein Entgelt – die sogenannte Maklerprovision.
Das Rechtsverhältnis zwischen Makler und seinem Auftraggeber kommt durch einen Maklervertrag zustande. Im Regelfall ist der Auftraggeber allerdings nicht verpflichtet, das vorgeschlagene Geschäft anzunehmen. Dazu kann der Auftraggeber oder vielmehr der Wohnungssuchende auch weitere Makler beauftragen oder sich selbst auf die Suche nach einem geeigneten Mietobjekt machen.
Es sei denn, es wurde im Maklervertrag eine Alleinauftragsklausel festgelegt. Dann würde sich der Auftraggeber schadensersatzpflichtig machen, wenn er einen Vertragsabschluss mit einem anderen Immobilienmakler abschließen würde. Möglich ist aber immer noch ein Eigenabschluss, ohne einen Makler beauftragt zu haben.
Wenn ein Geschäft nicht zustande kommt, dann hat ein Makler nur das Recht auf Aufwandsentschädigung, wenn eine dementsprechende Klausel im Vorfeld vertraglich festgelegt wurde.

Ein Immobilienmakler erhält eine Maklerprovision, wenn er an seinen Auftraggeber tatsächlich eine Wohnung oder ein Haus vermitteln konnte und nun ein Mietvertrag rechtsgültig abgeschlossen wird. Bei der Vermittlung einer Mietwohnung darf die Maklerprovision im Höchstfall zwei Monatskaltmieten (genau 2,38 Nettokaltmieten) abzüglich der Nebenkostenvorauszahlung betragen. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer. Ungeachtet dessen muss dem Mietinteressenten klar sein, dass er eine solche Provision bei Vertragsabschluss zu zahlen hat.
Keine Maklerprovision darf ein Makler verlangen, wenn er preisgebundenen oder geförderten Wohnraum vermittelt, der wie Sozialwohnungen durch öffentliche Gelder finanziert wird.
Doch in im Zuges des neuen „Gesetzes zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten“ gilt das sogenannte Bestellerprinzip. Soll heißen, dass künftig der Vermieter die Maklerprovision bezahlen muss, da er ja den Makler mit seinem Vermittlungsgesuch „bestellt“ hat. Doch als Wohnungssuchender können Sie sich weiterhin an Makler wenden. Da Sie diesen dann jedoch „bestellen“, müssen Sie in der Regel auch die Provision tragen.
Wohnungseigentumsgesetz
Das Wohnungseigentumsgesetz ist ein bundesdeutsches Gesetz aus dem Jahr 1951, das auch im Zusammenhang mit dem Mietrecht zu betrachten ist. Mit Wohnungseigentum wird das Eigentum an einer einzelnen Wohnung benannt. Dieses Eigentum wird in der Regel durch einen Eintrag ins Grundbuch fundiert, dafür erhält es ein eigenes Grundbuchblatt.
Beim Wohnungseigentum handelt es sich um ein Sondereigentum, das mit einem Miteigentumsanteil am Grundstück sowie an gemeinsam nutzbaren Gebäudeteilen verbunden ist. Bekannter ist dafür eher der Begriff der Eigentumswohnung. Eine solche kann käuflich, durch Schenkung oder auch Vererbung erworben werden.
Wird eine Person Besitzer einer Eigentumswohnung, dann ist es üblich, dass das bisherige Alleineigentum geteilt oder etwa durch einen notariell zu beglaubigenden Vertrag an den neuen Miteigentümer übertragen wird. Dabei handelt es sich dann um eine Eigentümergemeinschaft, bei der sich jeder Eigentümer an die Gemeinschaftspflichten zu halten hat.
Betriebskostenverordnung
Seit 2004 gilt die neue Betriebskostenverordnung im Mietrecht. Sie regelt sämtliche Gepflogenheiten rund um die Betriebskosten. Die Betriebskosten sind im Allgemeinen auch als Nebenkosten zu verstehen. Sie sind Bestandteil der Gesamtmiete und müssen im Einzelnen im Mietvertrag aufgelistet sein. Dort werden die Betriebskosten im Vorfeld in einer Nebenkostenvorauszahlung festgelegt. Möglich ist jedoch auch eine Pauschale, in dem Fall ist eine Nachzahlung ausgeschlossen.
Nicht zu den Betriebskosten zählen zum Beispiel Kosten für die Hausverwaltung sowie Wartungs- oder Reparaturkosten. Die Betriebskosten umfassen allerdings u. a.:
- Wasserversorgungskosten
- Heizkosten
- Müllbeseitigungs- und Straßenreinigungskosten
- Kosten für einen eventuell vorhandenen Fahrstuhl
- Kosten für die Hausreinigung
- Kosten für die Hausbeleuchtung
- Kosten für einen Hauswart
- Kosten für einen Waschraum

Je nachdem, wie dann die jährliche Nebenkostenabrechnung bzw. Betriebskostenabrechnung aussieht, kann es sein, dass der Bewohner etwas von den Mietnebenkosten zurückbekommt oder aber nachzahlen muss. Das ist abhängig davon, wie viel Sie im jeweiligen Abrechnungszeitraum verbraucht haben (Heizung, Wasser).
Bei der Betriebskostenabrechnung berechnet sich die Verteilung der Nebenkosten entweder nach dem Anteil der Wohnfläche oder aber nach der Anzahl der im Haus oder in der Wohnung lebenden Personen.
Es kommt nicht selten vor, dass die Nebenkostenabrechnung fehlerhaft ist. In solch einem Fall hat der Hausbewohner zwölf Monate Zeit, die Betriebskostenabrechnung zu prüfen und – eventuell auch mit Hilfe von einem Anwalt für Mietrecht – dagegen vorzugehen.
Auch der Eigentümer des Hauses hat eine Frist von zwölf Monaten, nämlich um nach Ablauf des Abrechnungszeitraums dem Mieter die Nebenkostenabrechnung zukommen zu lassen, da er ansonsten auf diesen sitzen bleibt. Das heißt, der Hausbewohner hätte dann das Recht, die Nachzahlung nicht zu leisten.
Nettokaltmiete vs. Bruttokaltmiete vs. Bruttowarmmiete
Die Nettokaltmiete bezeichnet im Mietrecht den Hauptteil der Miete bzw. des Entgelts für die Überlassung einer Mietsache zum Gebrauch. Sie ist auch als Grundteil bekannt. Jedoch enthält die Nettokaltmiete noch keine Nebenkosten, wie die Betriebskosten. Die Nettokaltmiete wird in den meisten Fällen zur Berechnung vom Mietspiegel genutzt.
Die Bruttowarmmiete wird häufig ganz einfach als Warmmiete bezeichnet. Sie beschreibt sozusagen den Gesamtwert einer Mietegebühr samt Netto- oder Grundmiete plus allen anderen Nebenkosten sowie Betriebskosten, wie Müllabfuhr, Hausreinigung etc. und ebenso die Kosten für Warmwasser, Heizung, Grundsteuer und Versicherungen für Grundstücke.
Die Bruttokaltmiete hingegen besteht zwar aus der Grund- bzw. Nettomiete plus Nebenkosten. Im Gegensatz zur Bruttowarmmiete enthält sie nämlich auch Betriebskosten, davon ausgenommen sind jedoch die Heizkosten und die Warmwasserkosten. Bruttokaltmieten werden gegenwärtig eher selten abgeschlossen.
Heizkostenverordnung
Eine Sonderregelung gilt für Heizkosten und Warmwasser. Sofern der Fall eintreten sollte, dass im Mietvertrag keine Vereinbarungen zu Neben- und Betriebskosten enthalten sind oder diese nicht im Einzelnen benannt wurden, so hat der Mieter das Recht, lediglich die Nettogrundmiete bzw. die Nettokaltmiete zu zahlen. Als Ausnahme gelten die Heizkosten, da es eine gesonderte Heizkostenverordnung gibt.
Sie steht für eine möglichst gerechte Verteilung der verbrauchten Heizkosten je Bewohner bzw. je Mietpartei. Der Hausherr hat sich stets an die Heizkostenverordnung zu halten. Die Heizkostenabrechnung orientiert sich überwiegend am individuellen Verbrauch einer Mietpartei. Daher sind auch entweder ein Wärmezähler oder ein Heizkostenverteiler in den Wohnhäusern angebracht, an welchen der Zählstand jährlich abzulesen ist.
Rechtsbereiche, die dem Mietrecht unterliegen
Gewerbemietrecht
Im Mietrecht wird in der Regel zwischen der Vermietung von Wohnräumen und der sogenannten Gewerbevermietung unterschieden. Bei der Gewerbevermietung werden in der Regel Räume zur gewerblichen Nutzung vermietet, also auch um diese geschäftlich, freiberuflich oder etwa zu Verkaufszwecken zu verwenden. In der Regel wird dann ein Gewerbemietvertrag abgeschlossen,
Die Gewerbevermietung ist in einzelnen Fällen von der Pacht zu differenzieren, da bei einem Pachtvertrag noch das Recht zur Ziehung von Früchten hinzukommt, zum Beispiel beim Ackerbau oder der Obsternte. Der Unterschied zwischen Pacht und Miete liegt also darin, dass nicht nur leere Räumlichkeiten vermietet werden, sondern auch Rechte. So können beispielsweise auch Unternehmen, Fabriken oder Räumlichkeiten für Gastronomie mit Inventar verpachtet werden. Bei der Kündigung vom Pachtvertrag ist allerdings zu beachten, um welche Pachtform es geht. Bei der Landpacht gelten beispielsweise andere Kündigungsfristen.
Auch von der Wohnraumvermietung ist die Gewerbevermietung klar abzugrenzen. Da bei ersterem besondere Mieterschutzvorschriften gelten. Dahingegen kann ein Gewerbemietvertrag mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr formlos, also mündlich geschlossen werden. Darüber hinaus hat auch der Gewerbemietvertrag in Schriftform vorzuliegen.
Bei einer Gewerbevermietung kann der Vermieter wesentlich mehr Nebenkosten veranschlagen als bei einer Wohnraumvermietung. Dazu zählen also auch Verwaltungskosten oder Bewachungskosten. Daneben kann innerhalb des Gewerbemietvertrages ein Konkurrenzschutz vereinbart werden, welcher den Mieter als Schutz vor Konkurrenten im eigenen Hause schützt.
Eine Gewerbevermietung hat eine Kündigungsfrist von sechs Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres. Dies gilt für beide Vertragspartner. Befristete Gewerbemietverträge enden automatisch zum Ende der Mietzeit.
Mieterschutzrecht
Im Mietrecht bilden die Sozialklauseln das Herzstück. Dahinein zählt auch der Mieterschutz, der sich mit Themen wie Kündigung(sschutz), Mieterhöhung und anderen Schutzrechten auseinandersetzt.
Kündigung des Mietverhältnisses
In Deutschland genießt das Wohnungsrecht einen hohen Stellenwert. Daher kann ein Hauseigentümer einem Mieter laut Mietrecht nicht einfach so aus einer Laune heraus eine Kündigung aussprechen. Das kann nur geschehen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses vorzuweisen hat. Laut Gesetz ist das der Fall, wenn:
- der Bewohner seinen Verpflichtungen zur Zahlung der Miete schuldhaft nicht nachgekommen ist,
- der Bewohner nachhaltig zur Störung des Hausfriedens beigetragen hat (zum Beispiel andauernde Lärmbelästigung während der Nachtruhe – hier besteht sogar die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung)
- der Hausherr einen Eigenbedarf anstrebt
- der Vermieter durch die Weiterführung des Mietverhältnisses eine Wertminderung des Grundstücks erwarten würde und ihm dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstünde, da er an der Verwertung des Grundstücks gehindert wird (zum Beispiel beim Abriss eines alten Hauses, mit dem Zweck auf dem Grundstück ein neues zeitgemäßes Mietshaus zu bauen)

Will ein Vermieter ein Wohnmietverhältnis mit der Absicht kündigen, den Mietpreis für zukünftige Hausbewohner zu erhöhen, so ist eine Kündigung in diesem Sinne ausgeschlossen.
Eine Kündigung bedarf der Schriftform sowie der Angabe des Kündigungsgrundes. Ansonsten werden im Kündigungsschreiben nicht angegebene Gründe auch nicht bei einem eventuellen gerichtlichen Verfahren zur Wirksamkeit dieser Kündigung berücksichtigt. Es sei denn, diese Gründe sind erst im Anschluss entstanden. Der Mieter hat immer das Recht, Widerspruch gegen eine Wohnungskündigung einzulegen (§574 BGB).
Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung wird eine Interessensabwägung beider Parteien vorgenommen. Die berechtigten Interessen sowohl des Vermieters als auch des Mieters sind vor Gericht als gleichwertig anzusehen.
Sofern der Mieter eine grobe Pflichtverletzung begeht, wie etwa Zahlungsverzug der Miete, Lärmbelästigung während der Nachtruhe oder schwere Verstöße gegen die Hausordnung, hat der Eigentümer das Recht, auch eine fristlose Kündigung auszusprechen. Allerdings muss der Bewohner zuvor eine Abmahnung bekommen.
Es kann aber auch zu einer Räumungsklage kommen. Hierbei wird das Mietobjekt zwangsgeräumt. Laut Mietrecht ist jedoch das eigenmächtige Eindringen durch den Vermieter in die Wohnung nur dann gestattet, wenn das Mietverhältnis bereits beendet ist und der Bewohner sein Besitzrecht an der Wohnung verloren hat. Eine Räumungsklage droht, wenn es zwischen Mieter und Hausbesitzer zu unüberbrückbaren Differenzen kommt, der Bewohner der Kündigung wegen Eigenbedarf nicht entspricht oder er nach seinem Auszug noch diverse Gegenstände, Möbel oder gar Müll in der Wohnung zurückließ.
Weitere Ratgeber rund um die Mietkosten
Kündigung wegen Eigenbedarf
Wenn ein Hausherr als Kündigungsgrund Eigenbedarf angibt, dann bedeutet das, dass er, ein Familienmitglied oder eine dem Haushalt angehörige Person die Wohnung benötigt. Aber auch Eigenbedarf unterliegt strikten Regelungen. In den meisten Fällen trifft dies nur für nahe Angehörige zu oder für Personen, für welche der Vermieter eine sittliche Verantwortung trägt.
Gründe für eine Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf sind mitunter:
- Die ernste Absicht, selbst im eigenen Haus/Wohnung zu wohnen
- Wohnung und Arbeitsplatz am selben Ort zu vereinen
- Der Wunsch nach Kindern
- Durch Heirat, Ruhestand, Trennung o. ä. bedingte persönliche Veränderungen
- Die Absicht, eine Pflegeperson aufzunehmen
Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist beläuft sich im Mietrecht auf den (spätestens) dritten Werktag des Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats. Für den Vermieter allerdings verlängert sich die Kündigungsfrist. Einmal um drei Monate, wenn dem Mieter der Mietraum fünf Jahre überlassen wurde und noch einmal um drei Monate, wenn es acht Jahre sind. Das bedeutet, während der Hausbewohner eine Kündigungsfrist von drei Monaten hat, hat der Hauseigentümer eine Frist von bis zu neun Monaten.
Mieterhöhung
Die beiden Vertragspartner können laut § 557 BGB eine Erhöhung der Miete im Laufe des Mietverhältnisses vereinbaren. Dessen ungeachtet kann eine Erhöhung des Mietentgelts nur aus Gründen der in §§ 558 bis 560 BGB erwähnten Punkte stattfinden. Das sind zum Beispiel:
- Mieterhöhung wegen Angleichung zur ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel)
- Mieterhöhung nach eingehender Modernisierung
- Mieterhöhung wegen Erhöhung der Betriebskosten

Solche zukünftigen Änderungen der Miethöhe können im Mietrecht entweder als Staffelmiete oder als Indexmiete vereinbart werden. Bei einer Staffelmiete wird im Vorhinein bereits vertraglich festgelegt, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt die Mieterhöhung stattfindet.
Die Indexmiete ist hingegen eine variable Mieterhöhung. Es wird davon ausgegangen, dass eine Miete nie dauerhaft auf einen festen Wert ausgerichtet ist. Die Indexmiete orientiert sich am Lebenshaltungskostenindex, welcher in regelmäßigen Abständen durch das Statistische Bundesamt ermittelt wird. Bei einer Indexmiete steht allerdings u. a. fest, dass
- der Mietpreis für jeweils ein Jahr unverändert bleibt,
- die Mieterhöhung schriftlich an den Mieter herangetragen wird
- bei einer Erhöhung wegen einer Modernisierung, diese durch eine gesetzliche oder behördliche Auflage erfolgte
Eine Miete darf sich normalerweise nicht um mehr als 20 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöhen. Bei einer Modernisierung kann der Vermieter die Mietgebühr jährlich auf bis zu 11 Prozent der aufzuwenden Kosten veranschlagen. Eine Mieterhöhung muss schriftlich und unter Darlegung der Gründe geltend gemacht werden.
Mietpreisbremse
Die sogenannte Mietpreisbremse tritt am 1. Juni 2015 in Kraft. Sie soll dafür Sorge tragen, dass auch Normalverdiener die Miete bezahlen können und diese nicht mehr so schnell in die Höhe steigt. Das war nämlich in den letzten Jahren drastisch der Fall. Laut der Zeitung „Die Welt“ stieg in Berlin der Mietpreis in den vergangenen zehn Jahren um 45 Prozent an, in München immerhin um 27 Prozent.
Doch jetzt kommt das neue „Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten“. Das bedeutet, dass in bestimmten Gebieten die Miete bei Mietvertragsabschluss nicht mehr als zehn Prozent über der Ortsvergleichsmiete liegen darf. Die ortsübliche Vergleichsmiete ergibt sich in der Regel aus dem Mietspiegel. Somit sollen die Mieten also gedeckelt oder gedämpft werden.
In Deutschland legen die einzelnen Länder fest, wo die Mietpreisbremse genau eingeführt wird. Berlin ist dabei das einzige Bundesland, welches die Mietpreisbremse auf dem gesamten Gebiet umsetzen will. Ausnahmen für die Mietpreisbremse gelten bei:
- Neubauten
- Modernisierungen in umfassenden Umfang
- Alle bereits bestehenden Miethöhen
Vermieterpfandrecht
Mit dem Vermieterpfandrecht erhält der Hausbesitzer im Rahmen vom Mietrecht bei Ausbleiben der Miete oder sonstigen Forderungen ein Pfandrecht an Gegenständen, welche sich in der Wohnung des Mieters befinden. Allerdings regelt das Vermieterpfandrecht, dass es auch unpfändbare Gegenstände gibt, wie etwa der Kühlschrank, Fernseher oder Kleider sowie persönliche Dinge, die tatsächlich dem Bewohner der Wohnung gehören.
Was wird durch das Mietrecht geregelt?
Mietvertrag
Ein Mietvertrag muss nicht unbedingt schriftlich abgeschlossen werden. Es sei denn, es handelt sich um Wohnraum, Grundstücke oder Geschäftsräume, die länger als ein Jahr zu vermieten sind, oder aber um einen Leasingvertrag für ein Auto. Dann sind natürlich bestimmte Rechte und Pflichten der Parteien aufzuführen.
Sofern ein solcher Mietvertrag nicht schriftlich festgehalten wurde, gilt dieser nicht in jedem Fall gleich als nichtig. Vielmehr besteht er auf unbestimmte Zeit und die Kündigung erfolgt frühestens zum Ende des jeweiligen Jahres, nachdem die Mietsache an die jeweilige Person zur Benutzung überging.

Mietverträge werden im Normalfall nicht vom Vermieter oder Mieter selbst gestaltet. In den häufigsten Fällen nutzen die Parteien dafür einen Mustervertrag. Diesen stellen verschiedene Institutionen zur Verfügung: zum einen das Bundesjustizministerium oder zum anderen auch Mieter- sowie Vermietervereinigungen. Solche Musterverträge existieren in ganz verschiedenen Varianten.
Jedoch muss dieses vorgefertigte Vertragsmuster natürlich noch angepasst werden. Das bedeutet, der Inhalt muss von den Vertragspartnern genau vereinbart werden und dementsprechend auch den AGBs – den allgemeinen Geschäftsbedingungen – gleichkommen.
Grundsätzliche Rechte und Pflichten
Grundsätzlich haben der Mieter und der Vermieter gleichermaßen Pflichten und Rechte. Das Mietrecht regelt zum Beispiel die Fälligkeit der Miete. Sie fällt für jedes zu vermietendes Objekt unterschiedlich aus. Für Wohnraum wird daher die Miete stets am Anfang des jeweiligen Zeitabschnitts (meist je Monat) entrichtet; allerspätestens am dritten Werktag (§§556b BGB).
Die Miete für alle beweglichen Sachen, aber auch für Grundstücke ist hingegen immer am Ende der Mietzeit zu zahlen. Im Vertrag können die Parteien allerdings auch andere Zahlungsgepflogenheiten vereinbaren.
Es ist üblich, dass der Hausherr eine Kaution von der maximalen Höhe dreier Monatskaltmieten verlangt, welche möglichst vor Mietantritt hinterlegt werden soll. Dieses Recht hat der Vermieter, damit er seine Ansprüche auf das Mietentgelt sichern kann, falls der Mieter einmal nicht zur Zahlung fähig sein sollte.
Der Hausbesitzer trägt durch den Mietvertrag allerdings die Pflicht, den Wohnraum bzw. die Mietsache in einem geeigneten Zustand, wie vertragsmäßig festgelegt, zu überlassen. Während der gesamten Mietzeit hat der Vermieter dafür Sorge zu tragen, dass der Zustand der Wohnung erhalten bleibt; er hat also eine Instandhaltungspflicht. Diese suggeriert allerdings nicht, dass die jeweilige Mietsache modernisiert oder in einer anderen Art und Weise verbessert wird.
Sogenannte Schönheitsreparaturen werden innerhalb des Mietvertrags zumeist dem Hausbewohner auferlegt. Dabei handelt es sich vordergründig um Malerarbeiten, die zur Instandhaltung beitragen. Gegebenenfalls sind hier auch Fristen festgelegt, die nicht zu knapp bemessen sein dürfen. Zulässig ist beispielsweise:
- Küche und Bad: alle drei Jahre
- Alle übrigen Wohnräume: alle fünf Jahre
- Nebenräume: alle sieben Jahre
Die Außenfassade bleibt jedoch in jedem Fall Sache des Vermieters.
Mehr Ratgeber rund um die Kündigung finden Sie hier
Kleinreparaturen
Die Kleinreparaturklausel ist Bestandteil in vielen Mietverträgen. Diese betrifft sogenannte Bagatellschäden, deren Reparaturkosten der Mieter bei Beträgen zwischen 75 und 100 Euro selbst tragen muss. Unabhängig davon, ob er den Schaden selbst zu verschulden hat, ist das aber nur der Fall, wenn es sich um Sachen handelt, auf welche der Bewohner direkt Zugriff hat (laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH)). Das können u. a. sein:
- Klingelanlagen
- Markisen oder Rollläden
- Verschlüsse der Fenster
- Heizungsrohre
- Verputzte Kabel
- Lichtschalter
Bei häufig vorkommenden Kleinreparaturen sollte ein angemessener Maximalbetrag festgelegt sein, der pro Jahr anzulegen ist. Dieser darf eine Monatsmiete nicht übersteigen. Die Kleinreparaturklausel wird im Ganzen als unwirksam angesehen, wenn keine Obergrenze für die Kosten im Mietvertrag festgelegt wurde. Wenn die Kosten einer Reparatur den benannten Höchstbetrag übersteigen, so hat der Vermieter diese in vollem Umfang zu begleichen.
Untervermietung
Um eine Mietsache weiterzuvermieten, bedarf es laut Mietrecht der Zustimmung des Vermieters. Eine solche Untervermietung kann der Vermieter aber nur ablehnen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Das ist der Fall, sofern etwas gegen den Untermieter spricht oder etwa die Wohnung durch eine Untervermietung überbelegt wäre.
Wird der Untervermietung zugestimmt, so haftet allerdings der Mieter für eventuelle Schäden des Untermieters gegenüber dem eigentlichen Hausherrn, quasi wie ein selbstschuldnerischer Bürge. Zudem gibt es bei einer Untervermietung zwei Verträge. Somit schließt zum einen der Untermieter einen Untermietvertrag mit dem Hauptmieter ab und zum anderen wird ein weiterer Vertrag zwischen Untermieter und Vermieter abgeschlossen.
Mieter haben das Recht, den Ehepartner mit in einer Wohnung wohnen zu lassen, ohne eine Erlaubnis des Vermieters einzuholen. Allerdings bedarf der Einzug des Ehegatten einer Mitteilung.
Haustiere

Ein striktes Verbot zur Haltung von Haustieren in einer Wohnung gibt es im Mietrecht nicht, da Kleintiere (z.B. Goldhamster) und Tiere, wie Zierfische oder Kanarienvögel, den Wohnwert und die Nachbarschaft nicht herabsetzen oder beeinträchtigen. Solche Klauseln sind im Mietvertrag ungültig. Doch in Bezug auf größere Tiere, wie Hunde und Katzen, ist eine Haustierklausel dieser Art zum Teil wirksam, da diese Tiere sich frei bewegen können.
Sofern sich eine Haltung von Hunden und Katzen aber im Rahmen hält und dadurch mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen ist, muss der Vermieter auch diesem Wunsch des Mieters entsprechen. Untersagt werden, kann hingegen die Aufnahme von Kampfhunden, Giftschlangen oder sonstigen Raubtieren, da von ihnen eine potenzielle Gefahr ausgeht.
Weiterführende Ratgeber zum Mietrecht bei Tieren
Mietspiegel
Laut einer Statistik des Statistik-Portals statista aus dem Jahr 2015 liegt München mit einem Mietpreis von über 15 Euro pro Quadratmeter bei den Neuvertragsmietpreisen deutschlandweit am höchsten. Danach folgt Stuttgart mit 12,2 Euro pro Quadratmeter. Berlin liegt dabei auf Platz neun mit 10,6 Euro pro Quadratmeter.
Der sogenannte Mietspiegel zeigt die ortsübliche Vergleichsmiete an. Im Grunde ist er eine Art Orientierungsrahmen für Mieten in verschiedenen Wohnungstypen an. Dabei werden die Art der Wohnung, ihre Größe und Lage sowie ihre Ausstattung zum Vergleich herangezogen. Das heißt, viele Gemeinden veröffentlichen diesen Mietspiegel, damit sich Wohnungssuchende über aktuelle Mietpreise erkundigen können.
In der Regel können Sie sich bei den jeweiligen Gemeinde- und Stadtverwaltungen über den aktuellen Mietspiegel in Ihrer Umgebung informieren sowie darüber, ob ihre Region solch einen Mietspiegel überhaupt anbietet. Denn es existieren nicht überall Mietspiegel, da es dazu keine Verpflichtung gibt und seine Erstellung kein Verwaltungsakt ist.
Der Mietspiegel wird in etwa alle zwei bis vier Jahre erhoben und orientiert sich an wissenschaftlichen Grundsätzen. Zudem wird in den meisten Fällen die Nettokaltmiete zur Berechnung herangezogen. Der Mietspiegel wird daneben in verschiedene Kategorien unterteilt (Stadtbezirk, Baujahr, usw.).
Mietminderung bei Sachmängeln oder Mietmängeln (Sachmängelhaftung)
Der Vermieter trägt laut Mietrecht im Regelfall die Sachmängelhaftung für bewegliche und unbewegliche Dinge, wenn diese Mängel oder Schäden aufweisen oder diese später entstehen. Diese Haftung entspricht der Gewährleistung im Kaufrecht. Die Gewährleistung beschreibt die gesetzliche Pflicht eines Schuldners, dafür einzustehen, dass eine Sache oder ein Recht frei von Mängeln ist.
Die Rechtsprechung besagt, dass ein Sachmangel vorliegt, wenn die Mietsache sich nicht, wie im Mietvertrag festgelegt, in dem Vereinbarungszustand befindet. Ist also die Mietsache bei der Gebrauchsüberlassung mit einem Sachmangel behaftet (wie Schimmelpilz, bröckelnde Wände oder Heizungsausfall), dann kann der Mieter die ihm vom Gesetzgeber gegebenen Mittel zur Mängelbeseitigung anwenden.

Eines dieser Mittel ist die Mietminderung. Das bedeutet, dass der Mieter seine Miete einkürzen, eben mindern, kann. Die Höhe der Mietminderung wird prozentual berechnet und hängt ganz davon ab, welche Art von Mangel die Mietsache aufweist. Dabei können ebenso äußere Umstände diesen Sachmangel hervorrufen, welche der Mietsache zwar nicht direkt anhaften, jedoch trotzdem auf sie einwirken, beispielsweise:
- Lärmbelästigung zum Beispiel durch eine Baustelle
- Ruhestörung durch den Nachbar
- Geruchsbelästigung
- Störende Beleuchtung
Somit muss der Vermieter den Mangel nicht einmal selbst verschuldet haben. Eine häufige Rolle spielt dabei der sogenannte Nachbarschaftsstreit. Zu erwähnen sind dabei unerträglicher Grillgeruch, erhebliche Lärmbelästigung oder auch über den Gartenzaun hängende Äste sowie unkontrolliert wuchernde Hecken. Doch auch beim Nachbarschaftsstreit kann eine Mietminderung vorgenommen werden, da solche Störungen ebenfalls einen Mietmangel darstellen.
Zu beachten sind dabei das Nachbarrecht bzw. die Nachbarschaftsgesetze der einzelnen Bundesländer. Sie enthalten Vorschriften zu den Rechten und Pflichten der Nachbarn. Solche Bestimmungen können aber teilweise auch schon im Mietvertrag geregelt sein, zum Beispiel wenn es um das Grillen auf dem Balkon geht.
Ein Sachmangel kann allerdings auch bei Fehlern zu den zugesicherten Eigenschaften einer Mietsache stehen, wenn zum Beispiel die Größe der Räume nicht stimmt.
| Mietminderung um | Sachmängel |
|---|---|
| 5 % | Verwahrlostes Treppenhaus, Funktionsuntüchtigkeit der Gegensprechanlage |
| 10 % | Kinderlärm innerhalb der Ruhezeiten, kleine Feuchtigkeitsschäden, laute Geräusche durch die Heizung, kein PKW-Stellplatz |
| 15 % | Sehr schlechte Heizleistung, Fehlende Wohnungseingangstür |
| 20 % | Undichte Fenster, Baustelle in der Nachbarschaft, Lärm durch Mitbewohner |
| 25 % | Wasserschäden an der Wohnzimmerdecke, |
| 30 % | Bodenkälte und erhebliche Feuchtigkeit in der Wohnung, Temperatur im Wohnzimmer liegt nur bei 15 Grad Celsius |
| 50 % | In der Wohnung sind alle Fenster undicht |
| 60 % | Erhebliche Lärmbelästigung/Belästigung allgemein durch Bauarbeiten im Haus selbst |
| 80 % | Die einzige Toilette in der Wohnung ist unbenutzbar |
| 100 % | Kompletter Umbau der Wohnung (Schmutz- und Lärmbelästigung) |
Die Mietminderungsquoten bei Mängeln können wie folgt aussehen:
Zudem kann der Mieter laut Mietrecht aber bei einem Sachmangel auch Schadensersatz verlangen oder das Mietverhältnis beenden, indem er (fristlos) kündigt. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht immer neben einer Mietminderung. Fristlos kann der Wohnungsinsasse nur kündigen, wenn der Vermieter die Frist zur Mängelbeseitigung nicht eingehalten hat oder der Sachmangel eine erhebliche Gesundheitsgefahr mit sich bringt.
Ist der Mietmangel im Vorfeld bekannt, so hat der Mieter keinerlei Ansprüche auf Mietminderung oder Schadensersatz etc. Dasselbe trifft zu, wenn er den Mangel eigens fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat, denn dann muss er selbst für die Beseitigung des Mangels aufkommen.
Wichtig ist, dass der Bewohner einen Mangel, der im Laufe der Mietzeit auftritt, so schnell wie möglich und unverzüglich dem Vermieter mitteilt, ansonsten würde der Mieter gegen die Anzeigepflicht verstoßen. In diesem Zusammenhang würde er seine Ansprüche auf Mietminderung und sonstige Rechte verlieren und sich sogar selbst schadensersatzpflichtig machen, wenn der jeweilige Mangel zu erheblicheren Schäden führen sollte.
Leasing
Beim Leasing können Sie bei gewerblichen Leasing-Unternehmen sowohl bewegliche als auch unbewegliche Sachen mittel- bis langfristig mieten. Diese Mietgegenstände werden Ihnen dann zur Nutzung über einen gewissen Zeitraum überlassen, wie etwa ein Mietwagen. Zu den Leasing-Unternehmen gehören zumeist:
- Tochtergesellschaften von Kreditunternehmen
- Tochtergesellschaften der Hersteller
- Hersteller selbst

Leasing bedeutet so viel wie „mieten“ oder „pachten“ (aus dem Englischen). Dabei bleibt das Leasingobjekt juristisches und wirtschaftliches Eigentum des Leasinggebers. Es wird jedoch dem Leasingnehmer überlassen, der dem Leasinggeber ein fest vereinbartes Entgelt bzw. eine Art Miete dafür zahlt. Dabei handelt es sich in der Regel um die Leasingrate.
Beim Leasing wird im Vorfeld ein Leasingvertrag abgeschlossen, der auch als eine Art Nutzungsüberlassungsvertrag verstanden werden kann. Am häufigsten werden Mietwagen geleast. Beim Aushandeln vom Leasingvertrag wird oftmals bereits über Kauf und Leasing parallel verhandelt, da bei Ablauf vom Leasingvertrag der Leasingnehmer darüber entscheiden kann, ob er
- den Mietwagen am Ende kauft,
- den Vertrag verlängert oder
- den Mietwagen an den Leasinggeber zurückgibt.
Daher nennt sich dieses Prozedere Finanzierungsleasing. Denn während der Leasingzeit zahlt der Leasingnehmer einen meist mehrjährigen festen Grundmietpreis bzw. eine Leasingrate. Am Ende bleibt ein Restwert, für welchen der Mietwagen dann gekauft werden kann. Dabei kommt die sogenannte Schlussfinanzierung ins Spiel oder auch die Ballonfinanzierung (Tilgung einer Finanzierung mit höherer Schlussrate).
Das bedeutet, dass die Autofinanzierung während der Laufzeit nur zu einem geringen Teil getilgt wird und am Ende bei Vertragsauslauf eine höhere Schlussrate folgt.
Allerdings ermittelt dann ein Gutachter des Leasing-Unternehmens den Restwert. Bei dieser Prüfung wird der derzeitige Wert vom Mietwagen ermittelt. Dahinein zählen Dinge wie Kratzer, Dellen oder auch die Laufzeit, welche den Wert erheblich mindern.
Es gibt viele unterschiedliche Formen des Leasings. Leasing und Miete sind aber voneinander zu unterscheiden. Zwar ist auch beim Mieten der Benutzer des Mietobjekts nicht dessen juristischer Eigentümer, aber im Gegensatz zum Mietvertrag besitzt der Leasingvertrag noch weitere Elemente, die über eine normale Gebrauchsüberlassung hinausgehen.
Übliche Vermieter-Aufgaben werden im Leasingvertrag auf den Leasingnehmer abgewälzt. Das bringt zusätzliche Pflichten mit sich, wie zum Beispiel Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen und Versicherungen.
Ein Leasingvertrag kann von beiden Vertragsparteien nur schwer bis gar nicht gekündigt werden. Allein der Leasinggeber hat das Recht zur Kündigung, wenn der Leasingnehmer die Leasingrate nicht mehr bezahlt.
Mietkauf
Leasing ist nicht gleich Mietkauf, da diese beiden Formen der Finanzierung steuerlich zu unterscheiden sind. Denn beim Mietkauf geht das wirtschaftliche Eigentum sofort auf den Mieter bzw. Käufer über – das juristische Eigentum hingegen erst nach Zahlung der Schlussrate.
Ein Mietkauf ist eher eine leichtere Finanzierungsmöglichkeit eines Gegenstandes als bei einem Sofortkauf. Denn beim Mietkauf schließen die Parteien den Vertrag (der ein Kaufvertrag ist) schon in der weisen Voraussicht, dass das Objekt am Ende gekauft wird. Die bis dahin gezahlte Miete wird auf den zuvor bestimmten Preis angerechnet.
Betreutes Wohnen
Im Mietrecht erhält auch die Bezeichnung „Betreutes Wohnen“ Einzug. Dies bezeichnet eine besondere Form eines Wohnverhältnisses. Alte Menschen oder Behinderte sowie psychisch Erkrankte, aber auch Obdachlose oder Jugendliche können in Wohnformen zum betreuten Wohnen untergebracht werden. Dort erhalten sie eine umfassende Betreuung und die Unterstützung zur Bewältigung eventueller Probleme.

Es gibt verschiedene Arten vom betreuten Wohnen. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, in der eigenen Mietwohnung wohnen zu bleiben und bei Bedarf einen ambulanten Pflegedienst oder ähnliches stundenweise zu beantragen. Bekannt ist auch das betreute Wohnen in therapeutischen Wohngemeinschaften. Hier werden die Bewohner in der Regel rund um die Uhr betreut.
Besonders für ältere Mitbürger, die jedoch noch ein Maß an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit bevorzugen, existieren solche Formen des betreuten Wohnens. Bei solchen speziellen Wohnungen schließen die Parteien zunächst einen ganz normalen Mietvertrag laut Mietrecht ab sowie zusätzlich einen Betreuungs- oder auch Servicevertrag. Dieser beinhaltet allgemeine Bestimmungen zu Unterstützungsleistungen sowie Grundleistungen. In der Regel sind die Wohnungen dann auch mit einem Hausnotruf ausgestattet.
Fazit
Das Mietrecht klärt alle Rechte und Pflichten von Mieter und Vermieter. Das Recht auf eine Wohnung besitzt deutschlandweit einen hohen Stellenwert, weshalb es unter besonderen Schutz gestellt wird und das Kündigen von Mietern nur unter spezifischen Bestimmungen rechtens ist. Das Mietrecht setzt sich mit dem Entgelt für das Mieten eines Objekts auseinander und beschreibt dabei auch die Nebenkosten bzw. Betriebskosten.
Zudem klärt es Problematiken zu Mieterhöhungen und Mietmängeln wie der damit in Verbindung zu bringenden Mietminderung. Bei Mietmängeln oder sonstigen Streitigkeiten mit dem Vermieter können Betroffene Kontakt zu einem Rechtsanwalt für Mietrecht aufnehmen und sich bei einer Beratung über mögliche rechtliche Schritte informieren.


 (39 Bewertungen, Durchschnitt: 4,05 von 5)
(39 Bewertungen, Durchschnitt: 4,05 von 5)
Guten Tag sehr geerthe Damen und Herren, Ich habe 2 Fragen die sehr wichtig sind.
1.) Mein Mietvertrag wurde von meiner Vermieterin am 15 Mai gekündigt da ihr Sohn in meine Wohnung einziehen sollte, Die Kündigungsfrist im Kündigungsschreiben betrug 2 Monate und 16 Tage. Desweiteren ist ihr Sohn mittlerweile in ein andere Wohnung hier bei uns eingezogen.
Ist die Kündigung überhaupt Wirksam oder noch Wirksam?
2.) Ich habe am 30.07.2024 ein Schreiben von meiner Vermieterin erhalten in dem steht das ich meinen Trockner in der Waschküche nicht mehr benutzen darf sondern nur noch die Waschmaschiene. Denn Trockner solle ich in meine Wohnung stellen. Mein Badezimmer ist so klein das ich direkt vor dem Waschbecken stehe wenn ich von der Toilette aufstehe da ist kein platz für einen Trockner. In den anderen Räumen stehen überall Möbel die durch einen Kondenstrockner zu Schaden kommen würden.
In meinem Mietvertrag steht Maschinelle Wascheinrichtung im Nebenhaus, Kosten in den Nebenkosten enthalten.
Kann ich dagegen etwas unternehmen?
Mit freundlichen grüßen Oliver G.
Hallo. Ich hätte bitte einige Fragen welche ich hier nicht beantwortet fand. Es handelt sich um folgendes: Da die vorherige Wohnung verkauft wurde mussten wir uns kurzfristig nach einer neuen umsehen. Meine Frau ist Thai und sie wollte nicht im Mietvertrag erwähnt werden da sie der Deutschen Sprache nicht mächtig ist, weder in Wort noch Schrift und daher nicht verstand was im Mietvertrag aufgeführt wurde. Dieses wurde abgelehnt. Dann wurde die Dauer auf zwei Jahre festgelegt was wir annehmen mussten da wir sonst die Wohnung wohl nicht bekommen hätten, wir aber kurzfristig eine brauchten und dem Vermieter dies auch bekannt war. Was wäre denn nun wenn wir ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollten? Wenn wir etwas zum Kauf finden würden, müssen wir diese zwei Jahre dann doch absitzen da wir unterschrieben haben auch wenn wir keine andere Wahl hatten? Danke.
Gut zu wissen, dass die Hausverwaltung auch berechtigt ist, einen Mietvertrag als rechtlichen Vertreter der Hausbesitzer zu unterschreiben. Auch interessant ist es, dass die Kosten für die Hausverwaltung nicht zu den Betriebskosten zählen. Mein Onkel ist am Überlegen, ob er für seine Eigentumswohnungen eine Hausverwaltung beauftragen soll, um ihm die Arbeit abzunehmen.
Meine Tochter hat in meinem Haus den Dachboden für ca.150,000€ ausgebaut. Hat sie einen Rechtanspruch auf Eigentum in Höhe dieser Summe?
Herzlichen Dank für Ihre Expertise zum Thema Wohnungseigentumsrecht. Es trifft sich gut, denn meine Mutter wird eine Eigentumswohnung durch Vererbung erwerben. Ich werde ihr weiterleiten, dass diese durch einen notariell zu beglaubigenden Vertrag an sie übertragen werden kann.
Das ist ein sehr interessanter Artikel zum Thema anwalt für Mietrecht. Ich habe mir schon einige Beiträge dazu durchgelesen.
Wohnfläche: Mietrecht – Wohnungseigentumsrecht
Warum kann die Einfügung „als Wohnfläche – oder besser noch die Nutzfläche ohne Türschwellen und Mauereinlassungen zum Balkon etc. – ist ausschließlich die tatsächlich vorhandene Fläche zu Grunde zu legen.
Guten Abend.
Darf der Haus-Vermieter zusätzlich zur Regelmiete und Nebenkosten auch den Pachtzins als Kosten auf die Nebenkostenabrechnung geben?
Interessant zu wissen, dass Hauseigentümer eine Kündigungsfrist von bis zu 9 Monaten haben. Ich habe eine Wohnung im Zentrum, die ich bis jetzt vermietet habe, aber möchte jetzt aufgrund des Nachwuchses in meiner Familie dorthin umziehen, um in der Nähe von Kitas und Schulen wohnen zu können. Ich werde mich bei meinem Anwalt weiter informieren, wie ich die aktuellen Mieter informieren soll.
Guten Morgen,
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und die über mir wohnen machen dauerlärm..Türen knallen schreien den ganzen Tag rum trampeln usw..es hört sich so an als würden die bei mir in der Wohnung sein.Ich halte das nicht mehr aus. Das geht von morgens Ca.11 Uhr bis Ca.22 Uhr mit kleinen Pausen von Ca.1-2 min…dazu kommt ja dann noch das Kind was dann auch schreit und weint wenn da immer soviel Theater ist. Ich verzweifel langsam ..
Liebes anwalt.org-Team, da hat aber jemand bei Ihnen das Abstraktionsprinzip nicht verstanden: Eigentümer- und Vermieterstellung müssen nicht zusammenfallen; selbstverständlich können das auch verschiedene Personen sein, die prinzipiell nichts miteinander zu tun haben müssen. Ein Mietvertrag kann rechtswirksam auch allein mit dem Ehemann als Vermieter geschlossen werden, selbst wenn dieser nicht Eigentümer der Immobilie ist, egal ob er von der Ehefrau hierzu ermächtigt wurde oder nicht. Ihre obigen Ausführungen würden nicht zu einer Vermieterstellung des Ehemannes führen, sondern nur zu einer Stellvertretereigenschaft desselben. Wie bekannt sein dürfte, kann man sich hierzulande rechtswirksam schuldrechtlich verpflichten, ohne die Verfügungsgewalt zu haben.
Ehefrau ist alleinige Eigentümerin der Wohnung darf Ihr Ehemannieser dann trotzdem mit mir einen Mietsvertrag abschlißen,ist d.ieser dann Rechskräftens.
Hallo Karsch,
handelt der Ehemann im Auftrag und hat eine entsprechende Vollmacht, kann ein Mietvertrag üblicherweise auch mit diesem geschlossen werden. Ist zudem im Mietvertrag auch festgehalten, dass der Ehemann die Vermieterin vertritt, ist dies in der Regel zulässig. Erkundigen Sie sich am besten bevor Sie den Vertrag unterschreiben, ob eine Vollmacht oder der Ehemann als Vertreter handelt vorliegt.
Ihr Team von anwalt.org
Sie müssen mir bitte helfen brauchen dringend, bin im Rechtschutzvericherung
Hallo niefuend,
eine individuelle Beratung durch einen Anwalt können wir Ihnen nicht gewährleisten. Hierzu müssen Sie sich an einen Anwalt mir entsprechender Spezialisierung wenden.
Ihr Team von anwalt.org