
Inhalt
FAQ: Abschiebeverbot
Das Abschiebungsverbot ist laut Definition eine Schutzform des Asylrechts. Diese kann Anwendung finden, wenn ein Schutz aufgrund von Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz nicht greift und eine Abschiebung verhindern.
Das Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) besteht, wenn die Rückführung ins Heimatland mit einer Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder mit einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einhergeht.
Nein, greift allerdings das Abschiebungsverbot, wird eine Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr erteilt, wobei eine wiederholte Verlängerung möglich ist.
Video: Abschiebung? Das müssen Sie jetzt wissen!
Was bedeutet ein Abschiebungsverbot?

Heißt es im Bescheid zum Asylantrag: „Das Abschiebungsverbot des § 60 Abs. 5 und 7 des Aufenthaltsgesetzes liegt vor.“ ist die Erleichterung meist groß, denn damit ist eine Rückführung in das Heimatland vorerst abgewendet. Doch was hat es konkret mit dem Abschiebeverbot auf sich?
Um festzustellen, ob in Deutschland ein Anspruch auf Asyl besteht, werden gemäß Asylrecht folgende vier Schutzformen nacheinander geprüft:
- Flüchtlingsschutz auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention
- Asylberechtigung für politisch Verfolgte
- Subsidiärer Schutz, wenn im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht
- Nationales Abschiebungsverbot
Greifen die ersten drei Schutzformen nicht, ist durch das Abschiebungsverbot unter bestimmten Voraussetzungen ein Verbleib in Deutschland möglich. Dieses hat einen zielstaatsbezogenen Charakter, weshalb es grundsätzlich die Situation im Herkunftsland zu prüfen gilt.
Die gesetzlichen Grundlagen für das Abschiebeverbot ergeben sich aus § 60 AufenthG. Dabei sind vor allem zwei Absätze von Bedeutung. § 60 Abs. 5 AufenthG befasst sich mit dem Verbot der Abschiebung aufgrund der Gefahr der Verletzung von Menschenrechten oder Grundfreiheiten gemäß der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Dies kann der Fall sein, wenn bei einer Heimkehr ein unfairer Prozess, Folter oder eine unmenschliche Behandlung droht.
§ 60 Abs. 7 AufenthG versagt eine Rückführung, wenn diese mit einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einhergeht. Dabei muss kein Verfolgungsakteur oder -grund vorliegen. So greift ein entsprechendes Abschiebungsverbot wegen Krankheit oder Naturkatastrophen.
Werden die Kriterien für § 60 Absatz 5 oder 7 AufenthG erfüllt, wird ein Abschiebungsverbot laut § 25 Abs. 3 AufenthG erteilt. Im Gesetzestext heißt es dazu:
Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt. Sie wird ferner nicht erteilt, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer
1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,
2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,
3. sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder
4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.
Im Video zusammengefasst: Wann besteht da Abschiebungsverbot?
Nationales Abschiebungsverbot: Für welche Länder besteht es?
Eine generelle Liste mit Staaten, in die aufgrund von Abschiebungsverboten keine Rückführung erfolgt, gibt es nicht. Vielmehr gilt es die individuellen Umstände der Geflüchteten und die aktuelle Situation im Heimatland zu bewerten.
Welche Rechte gelten für zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote?

Erkennt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Zuge des Asylverfahren ein nationales Abschiebungsverbot an, hat dies für den Asylbewerber weitreichende Rechtsfolgen. Denn wie zuvor ausgeführt, kann dadurch die Erteilung eines Aufenthaltstitels beantragt werden. Die Aufenthaltserlaubnis wird dabei üblicherweise für ein Jahr ausgestellt und kann wiederholt verlängert werden. Dies gilt allerdings nur solange, wie das Abschiebehindernis besteht.
Der Erhalt eines Aufenthaltstitels wirkt sich auch auf die Zuständigkeit der Behörden aus. Denn bevor ein solcher vorliegt, erhalten Geflüchtete ihre Leistungen vom Sozialamt. Besteht hingegen eine Aufenthaltserlaubnis durch das Abschiebeverbot gemäß AufenthG § 60 Abs. 5, ist das Jobcenter zuständig und es kann Bürgergeld beantragt werden.
Nicht nur für den Erhalt von Geldleistungen spielt der Schutzstatus eine entscheidende Rolle. Nachfolgend finden Sie Antworten zu einigen wichtigen Fragen rund um das Abschiebungsverbot:
- Kann man mit einem Abschiebungsverbot eine Niederlassungserlaubnis erhalten?
Nach fünf Jahren ist der Erhalt einer Niederlassungserlaubnis laut § 9 AufenthG möglich. Um eine Niederlassungserlaubnis bei bestehendem Abschiebungsverbot zu erhalten, müssen zudem weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu zählen unter anderem ausreichende Deutschkenntnisse und die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts.
- Kann man mit einem Abschiebungsverbot einen Familiennachzug machen?
Grundsätzlich ist bei einem bestehenden Abschiebeverbot ein Familiennachzug gemäß § 29 AufenthG möglich. Allerdings wird in diesem Fall kein vereinfachtes Verfahren gewährt.
- Kann man mit einem Abschiebungsverbot die Einbürgerung beantragen?
Für die Einbürgerung in Deutschland müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So schreibt der Gesetzgeber unter anderem eine bestimmte Mindestanzahl von Jahren vor, die ein Geflüchteter rechtmäßig in der Bundesrepublik leben muss. Darüber hinaus wird eine Niederlassungserlaubnis benötigt.
- Kann man mit einem Abschiebungsverbot reisen?
Ob Reisen bei einem nationalen Abschiebungsverbot möglich sind, hängt von den vorhandenen Ausweisdokumenten und dem Reiseziel ab. Insbesondere Reisen ins Heimatland können problematisch sein, denn erfährt die Ausländerbehörde von dieser, kann ein Widerruf beim Abschiebungsverbot und somit der Verlust des Aufenthaltsrechts drohen.
- Kann man mit einem Abschiebungsverbot arbeiten?
Der durch das Abschiebeverbot erworbene Aufenthaltstitel berechtigt gemäß § 4a AufenthG zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Aufenthaltserlaubnis wird dafür mit einem entsprechenden Vermerk ausgestellt. Alternativ dazu kann auch eine Ausbildung oder ein Studium begonnen werden.
Übrigens! Neben dem Abschiebungsverbot ist eine Duldung gemäß § 60a AufenthG möglich. Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Infrage kommt dies, wenn eine Rückführung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Möglich ist dies zum Beispiel, wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung absolviert, ein minderjähriges Kind mit Aufenthaltserlaubnis hat, Reisedokumente für die Ausreise fehlen oder der Gesundheitszustand eine Abschiebung nicht zulässt.

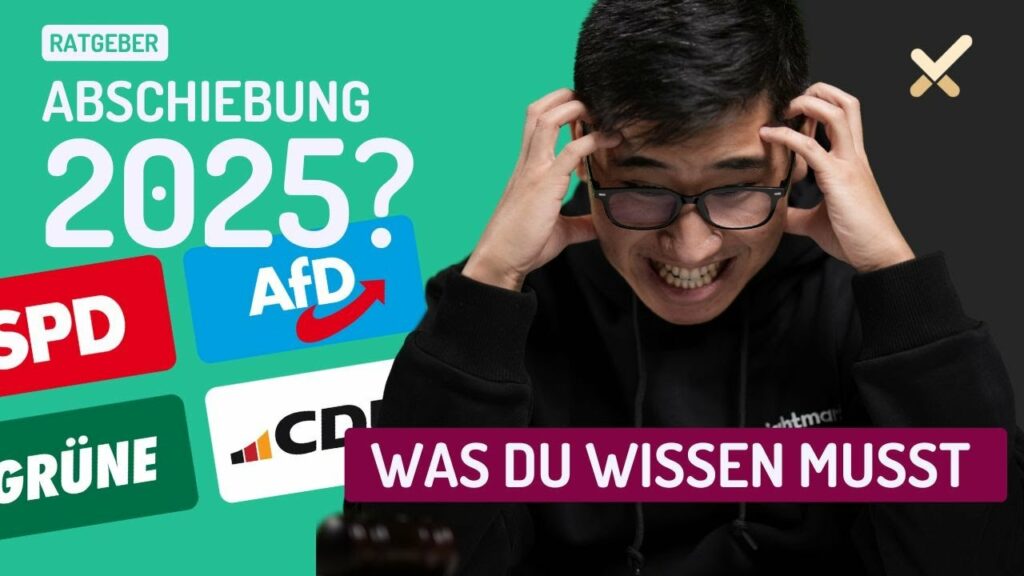
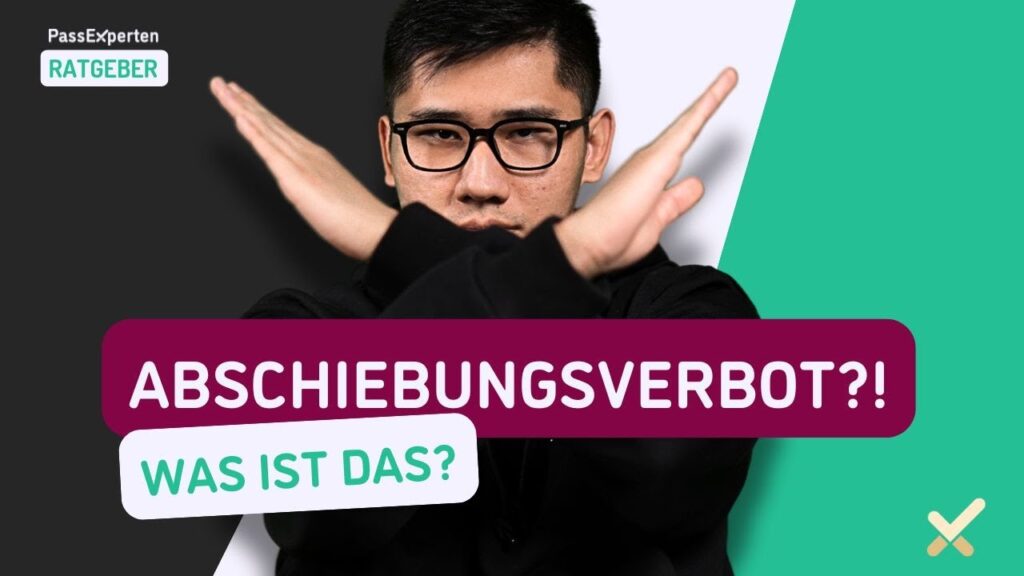

 (27 Bewertungen, Durchschnitt: 4,10 von 5)
(27 Bewertungen, Durchschnitt: 4,10 von 5)