
FAQ: Grundfreiheiten der EU
Es gibt vier Grundfreiheiten in der EU. Diese sind Teil des Europarechts. Sie regulieren unter anderem den freien Handel und die Wirtschaft in der Europäischen Union. Welche Grundfreiheiten es gibt, haben wir hier zusammengefasst.
Die Grundfreiheiten sind im EU-Vertrag (EUV) sowie im Vertrag über die Arbeitsweise (AEUV) definiert. Mehr zu den rechtlichen Grundlagen lesen Sie hier.
Die Grundfreiheiten dienen dem EU-Binnenmarkt, die Grundrechte gelten für jeden Einzelnen als persönliches Recht. Welche Grundrechte in Deutschland wo definiert sind, erfahren Sie hier.
Inhalt
Spezielle Ratgeber zu den Grundfreiheiten der EU:
Grundfreiheiten der EU: Per Definition einfach erklärt

Welche Grundfreiheiten gibt es in der EU? Bürger der Europäischen Union haben bestimmte Rechte und Freiheiten, die in der Union gesetzlich festgehalten sind. Zu diesen gehören die allgemeinen Grundrechte eines jeden Menschen sowie die Grundfreiheiten in der EU. Doch wo sind diese geregelt? Gibt es zu den Grundfreiheiten in der EU ein Gesetz?
Neben der „Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ spielen auch der „Vertrag der Europäischen Union (EUV)“ sowie der „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)“ hierfür eine wichtige Rolle. In diesen sind sowohl die Grundrechte als auch die Grundfreiheiten in der EU festgehalten.
Europäische Grundfreiheiten betreffen alle Mitgliedsstaaten und gelten grenzübergreifend. Sie dienen grundsätzlich dazu, die Zusammenarbeit und die Wirtschaft in der Union einheitlich zu gestalten und für alle EU-Bürger zugänglich zu machen. Es sind in der EU vier Grundfreiheiten über den AEUV und den EUV definiert.
Wie lauten die vier Grundfreiheiten der EU?
Die Bestimmungen in den Verträgen bilden die Basis für den EU-Binnenmarkt. Laut Artikel 3 EUV sind folgende Punkte als Grundfreiheiten per EU-Vertrag bestimmt:
Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem […] der freie Personenverkehr gewährleistet ist.
Die Union errichtet einen Binnenmarkt. […]
Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.
Im Vertrag über die Arbeitsweise (AEUV) ist eine Übersicht zu diesen Grundfreiheiten in der EU enthalten und diese werden näher definiert.
Zu wichtigen Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes gehören also vereinfacht gesagt, folgende:
- der freie Warenverkehr
- der freie Personenverkehr
- der freie Dienstleistungsverkehr und
- der freie Kapitalverkehr
Grundfreiheiten der EU: Beispiele näher erläutert

In der Praxis bedeutet das, dass in der Regel Grenzkontrollen wegfallen und EU-Bürger bzw. Personen mit legalem Aufenthalt sich frei innerhalb der Union bewegen dürfen. Dazu gehören auch die freie Wohnortwahl sowie die freie Wahl des Arbeitsortes.
Das heißt, dass nicht nur Reisen unbeschränkt möglich sind, sondern auch der langfristige Aufenthalt in den EU-Mitgliedsstaaten erlaubt ist. Das zeigt deutlich, dass die vier Grundfreiheiten in der EU direkte Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten haben. Die rechtliche Grundlage ist in den Artikeln 45 bis 55 AEUV zu finden. Neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind hier dann auch die Niederlassungs- und Reisefreizügigkeit definiert.
Für den Warenverkehr innerhalb der Union fallen keine Zölle an und jegliche Art von Dienstleistungen können in der EU angeboten werden. Der Warenverkehr kann also grenzübergreifend ohne Einschränkungen erfolgen. So ist in Art. 28 AEUV die Zollunion festgehalten und in Art. 30 AUEV das Verbot von Ein- und Ausfuhrzöllen für Waren innerhalb der Union. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Warenverkehrsfreiheit befasst.
Bedeutende Entscheidungen sind unter anderem:
- Dassonville,
- Cassis-de-Dijon und
- Keck
So legte der EuGH in der Dassonville-Entscheidung beispielsweise fest, dass staatliche Handelsregelungen nicht denen im AEUV entgegenstehen und den Handelsverkehr nicht behindern dürfen (EuGH, Juli 1974 – C 8/74, Dassonville, NJW 1975, 515 Rn. 5). Diese weite Auslegung wird durch die Keck-Entscheidung von 1993 etwas eingeschränkt. In bestimmten Fällen können Maßnahmen im Inland Verkaufsmodalitäten begrenzen. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht diskriminierend sein oder den generellen Zugang zum Markt des Mitgliedstaates einschränken.

Ähnlich gelagert ist das Urteil zur Cassis-de-Dijon-Entscheidung. Es dürfen nationale Hemmnisse für die Einfuhr geltend gemacht werden, wenn es zum Beispiel zum Umwelt-, Gesundheits- oder Verbraucherschutz notwendig ist. Andere Behinderungen im Binnenmarkt sind jedoch nicht zulässig.
Darüber hinaus gibt es in der EU zum Beispiel keine Beschränkungen im Zahlungsverkehr oder Devisenkontrollen. Hier greifen die Grundfreiheiten der EU auch für Drittstaaten. Denn auch Beschränkungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr zwischen Mitglieds- und Drittstaaten sind nicht zulässig, sofern sie das Handeln in der EU beschränken.
Sind Einschränkungen der Grundfreiheiten in der EU möglich?
Wie oben schon beschrieben, können die Grundfreiheiten unter bestimmten Umständen auch eingeschränkt werden. Das kann sowohl den Personen- als auch den Warenverkehr betreffen. So ist es beispielsweise nach Art. 52 AEUV die Niederlassungsfreiheit dann eingeschränkt werden, wenn es aus „Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt“ ist.
Aber auch eine Nichtanerkennung von Zeugnissen oder Ausbildungen kann zur Einschränkung der Grundfreiheiten in der EU führen. Das betrifft dann unter anderem oftmals die freie Wahl des Arbeitsortes und indirekt auch die Niederlassungsfreizügigkeit.
Die genannten Entscheidungen des EuGH sind als Beschränkungen der Waren- bzw. der Dienstleistungsfreizügigkeit zu sehen.
Unterschied zwischen Grundfreiheiten und Grundrechte in der EU
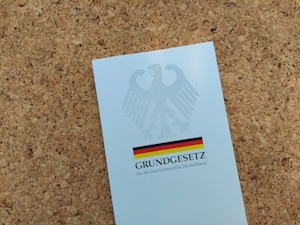
Die Grundfreiheiten der EU dienen dazu, den Binnenmarkt zu regeln. In der Union sind aber auch bestimmte Grundrechte von Bedeutung. Diese sind, wie erwähnt, in der „Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten” festgehalten. Sie beziehen sich anders als die Grundfreiheiten auf die persönlichen Grundrechte eines jeden EU-Bürgers. Im Rahmen der Funktionsweise EU sind die Grundfreiheiten jedoch in der Praxis wichtiger.
Das liegt unter anderem daran, dass die Grundrechte in jedem Mitgliedstaat in den nationalen Gesetzen festgehalten sind. In Deutschland ist das das Grundgesetz. Somit sind die Grundrechte auf nationaler Ebene den Grundfreiheiten gleichgestellt.
Zu den Grundrechten, die im Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19 definiert sind, gehören unter anderem Folgende:
- Bekenntnis zu Menschenrechten
- „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“
- Religions- und Glaubensfreiheit
- Meinungsfreiheit
- Gleichberechtigung
- Keine Diskriminierung aufgrund von z. B. Religion, politischer oder religiöser Anschauung, Geschlecht, Abstammung, Sprache, Behinderung
- Versammlungsrecht


 (34 Bewertungen, Durchschnitt: 4,10 von 5)
(34 Bewertungen, Durchschnitt: 4,10 von 5)