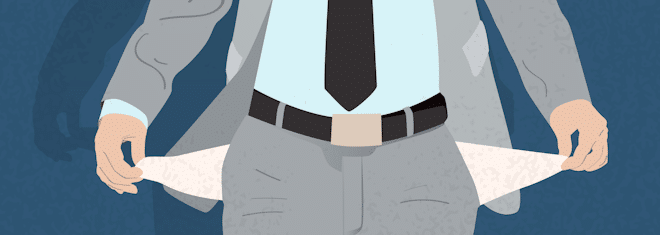
FAQ: drohende Zahlungsunfähigkeit
Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt laut Insolvenzrecht vor, wenn ein Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine bestehenden Zahlungspflichten bei Fälligkeit zu erfüllen. Definiert wird die drohende Zahlungsunfähigkeit in der Insolvenzverordnung.
Bei Zahlungsunfähigkeit droht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, bei dem das Vermögen des Schuldners zur Befriedigung der Gläubigeransprüche verwertet wird. Wer davon betroffen sein kann, erfahren Sie hier.
Das Verschleiern einer drohenden Zahlungsunfähigkeit kann zwar nicht direkt sanktioniert werden, jedoch kann bei später eintretender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eine verspätete Insolvenzantragstellung zu Haftungsansprüchen gegen die Geschäftsführung führen.
Inhalt
Wann liegt eine drohende Zahlungsunfähigkeit vor? Eine Definition

Liquiditätsprobleme kommen selten plötzlich oder unerwartet. Meistens machen sie sich schon früh bemerkbar, sodass Unternehmer oder Unternehmen rechtzeitig reagieren können. Ein Hinweis auf bevorstehende Probleme sind zum Beispiel sinkende Einnahmen oder Zahlungsverzögerungen von Kunden oder Geschäftspartnern. Wenn solche Dinge über längere Zeit passieren, kann dies zu finanziellen Schwierigkeiten führen.
Wird absehbar, dass ein Schuldner seine Verpflichtungen in naher Zukunft nicht mehr erfüllen kann, besteht eine drohende Zahlungsunfähigkeit. § 18 InsO beschreibt dies genauer:
Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen.
Wichtig ist für die Bewertung, ob eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt, der Prognosezeitraum. Gemeint ist damit der Zeitraum, für den die Zahlungsfähigkeit des Schuldners vorausschauend beurteilt werden muss.
Laut Rechtsprechung beträgt dieser Zeitraum regelmäßig 24 Monate, kann jedoch in Einzelfällen auch kürzer oder länger ausfallen – abhängig von der Art des Unternehmens und der Planbarkeit der Einnahmen und Ausgaben. Innerhalb dieses Zeitraums muss geprüft werden, ob der Schuldner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der Lage sein wird, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Laut eines Urteils des BGH liegt eine drohende Zahlungsunfähigkeit vor, wenn die Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit größer ist als die des Nichteintritts. Sie erlaubt es dem Schuldner, frühzeitig Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, bevor eine akute Insolvenz eintritt. (Urteil vom 5. Dezember 2013, IX ZR 93/11)
StaRUG: Welche Voraussetzungen gelten bei der Anwendung?

Die drohende Zahlungsunfähigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für die Anwendung des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens (StaRUG) in Deutschland.
Das StaRUG bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich frühzeitig, also vor einer Insolvenz, zu restrukturieren und Schulden zu bereinigen – außerhalb eines Insolvenzverfahrens, aber unter gerichtlicher Kontrolle.
Es richtet sich an Unternehmen in wirtschaftlicher Krise, aber noch nicht zahlungsunfähig oder überschuldet.
Die Voraussetzungen, die dafür gelten müssen, sind:
- Um das StaRUG anzuwenden, muss drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen.
- Ein Restrukturierungsvorhaben muss beim zuständigen Gericht angezeigt werden.
- Es dürfen keine bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung bestehen.
Insolvenzgrund für die drohende Zahlungsunfähigkeit: Zahlungsunfähig oder nur in Gefahr?
Wenn Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, kommt es auf die genaue Art der Krise an, wenn es um die rechtliche Beurteilung geht. Ist beispielsweise drohende Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzgrund?
Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung – und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
| Kriterium | Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) | Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) | Überschuldung (§ 19 InsO) |
|---|---|---|---|
| Definition | Der Schuldner kann fällige Zahlungspflichten nicht mehr erfüllen. | Der Schuldner wird voraussichtlich nicht in der Lage sein, fällige Zahlungspflichten zu erfüllen. | Die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen, und es fehlt an einer positiven Fortführungsprognose. |
| Zeitlicher Bezug | Gegenwartsbezogen: Prüfung der aktuellen Zahlungsfähigkeit. | Zukunftsgerichtet: Prognosezeitraum von bis zu 24 Monaten. | Gegenwarts- und zukunftsgerichtet: Prüfung der Vermögenslage und Fortführungsprognose für die nächsten 12 Monate. |
| Insolvenzantragspflicht | Pflicht für den Schuldner bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 15a InsO). | Keine Pflicht, aber Möglichkeit für den Schuldner, einen Insolvenzantrag zu stellen. | Pflicht für juristische Personen bei Überschuldung ohne positive Fortführungsprognose (§ 15a InsO). |
| Wer kann einen Antrag stellen? | Schuldner und Gläubiger | Schuldner | Schuldner |
Wer kann von drohender Zahlungsunfähigkeit betroffen sein?

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit kann verschiedene Personengruppen und Organisationen betreffen, darunter Unternehmen, Privatpersonen, Vereine und Einzelunternehmer.
Die Auswirkungen und rechtlichen Konsequenzen variieren je nach Art des Schuldners. In jedem Fall ist es von entscheidender Bedeutung, die drohende Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig zu erkennen und zu prüfen, um entsprechende Maßnahmen zur Abwendung der Insolvenz oder zur rechtzeitigen Beantragung eines Insolvenzverfahrens zu ergreifen.
Drohende Zahlungsunfähigkeit bei einer GmbH
Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt bei einer GmbH vor, wenn diese voraussichtlich nicht mehr in der Lage ist, ihre Schulden zu begleichen (§ 18 InsO). Zwar besteht in diesem Stadium noch keine Insolvenzantragspflicht, aber der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Liquidität regelmäßig zu prüfen und frühzeitig gegenzusteuern.
Typische Maßnahmen sind:
- Sanierungsversuche
- Verhandlungen mit Gläubigern
- oder die Suche nach frischem Kapital.
Eine Liquiditätsplanung über 24 Monate ist dabei besonders wichtig. Kommt es trotz Warnzeichen zu einer echten Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, müssen Sie innerhalb von drei Wochen ein Insolvenzantrag stellen – andernfalls droht Ihnen als Geschäftsführer persönliche Haftung und strafrechtliche Konsequenzen.
Drohende Zahlungsunfähigkeit bei Privatpersonen

Die drohende Zahlungsunfähigkeit bei einer Privatperson tritt ebenfalls ein, wenn diese voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ihre bestehenden Zahlungspflichten bei Fälligkeit zu erfüllen (§ 18 Abs. 2 InsO).
Typische Ursachen können sein:
- Berufsunfähigkeit: Erkrankungen oder Unfälle, die zu Einkommensverlust führen
- Scheidung: Kosten für Unterhalt, Vermögensaufteilung und Rechtsverfahren können schnell zur finanziellen Überforderung führen.
- Hohe Schadensersatzforderungen: können entstehen, wenn keine Versicherung vorhanden ist und die Forderungen die finanzielle Leistungsfähigkeit übersteigen.
Drohende Zahlungsunfähigkeit bei einem Verein
Handelt es sich nur um eine drohende Zahlungsunfähigkeit, besteht keine Antragspflicht, jedoch sollte der Vorstand frühzeitig Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität ergreifen.
Tritt die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich ein oder ist der Verein überschuldet, muss der Vorstand gemäß § 42 Abs. 2 BGB unverzüglich einen Insolvenzantrag stellen. Eine Verzögerung kann zur persönlichen Haftung der Vorstandsmitglieder führen, auch mit ihrem Privatvermögen. Während eines Insolvenzverfahrens bleibt der Verein handlungsfähig, wird jedoch aufgelöst, sofern keine Fortführung beschlossen wird.
Drohende Zahlungsunfähigkeit für Einzelunternehmer
Einzelunternehmer können frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Dazu zählen unter Anderem:
- die Einbringung privaten Kapitals
- der Verkauf von Vermögenswerten
- oder Verhandlungen über Zahlungsaufschübe mit Gläubigern.
In keinem dieser Fälle löst eine drohende Zahlungsunfähigkeit eine Insolvenzantragspflicht aus, erlaubt jedoch die Einleitung eines Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahrens, um die finanzielle Situation zu stabilisieren und eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.
Welche Beispiele gibt es für drohende Zahlungsunfähigkeit? Ein Unternehmen kann betroffen sein, wenn ein Großkunde abspringt, eine Kreditlinie gekürzt wird oder Fördermittel wegfallen. Privatpersonen können durch Berufsunfähigkeit, hohe Schadensersatzforderungen oder die finanziellen Folgen einer Scheidung in eine solche Lage geraten. Auch Vereine und Einzelunternehmer stehen vor drohender Zahlungsunfähigkeit, wenn Einnahmen ausbleiben oder unvorhergesehene Kosten auftreten, die nicht gedeckt werden können.
Eigenverwaltung bei drohender Zahlungsunfähigkeit

Die Eigenverwaltung ist ein Verfahren im Rahmen des Insolvenzrechts, das Schuldnern ermöglicht, unter gerichtlicher Aufsicht selbstständig Maßnahmen zur Sanierung ihres Unternehmens durchzuführen. Sie kommt insbesondere für die drohende Zahlungsunfähigkeit infrage, wenn noch Aussicht auf eine erfolgreiche Restrukturierung besteht.
Voraussetzungen für die Eigenverwaltung sind:
- Ein Antrag des Schuldners
- Eine positive Fortführungsprognose
- Keine Hinweise auf vorsätzliche Insolvenzverschleppung oder Gläubigerbenachteiligung
Die Eigenverwaltung bietet Unternehmen den Vorteil, dass sie weiterhin eigenständig handeln können und nicht durch einen Insolvenzverwalter ersetzt werden. Dies stärkt das Vertrauen von Geschäftspartnern und erleichtert oft die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen.


 (45 Bewertungen, Durchschnitt: 4,60 von 5)
(45 Bewertungen, Durchschnitt: 4,60 von 5)